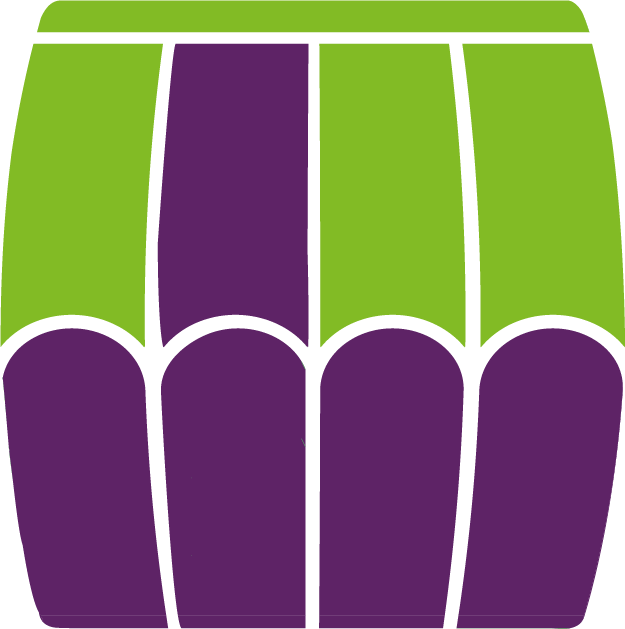Der aktuelle Verfassungsschutzbericht der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sollte eigentlich ein Zeichen für Wachsamkeit, Effizienz und Durchsetzungskraft sein. Doch bei näherer Betrachtung offenbart das Dokument eine gefährliche und systematische Schwäche. Es entsteht der Eindruck, als diene der Bericht nicht der nüchternen Analyse, sondern der Selbstabsicherung. Der millionenteure Apparat offenbart damit ein erschreckendes Maß an Unwirksamkeit und Realitätsverweigerung.
Spionage: nur Zwei Fälle
Im Zentrum der Kritik steht der Abschnitt zu Spionage und nachrichtendienstlichen Aktivitäten. Im gesamten Jahr 2024 wurden lediglich zwei Spionagehandlungen registriert. Im Vorjahr waren es noch vier. Der Rückgang um fünfzig Prozent wird als Erfolg dargestellt. Die Aufklärungsquote liegt bei hundert Prozent. Doch dieser scheinbare Erfolg ist in Wirklichkeit Ausdruck einer dramatischen Untererfassung. Es bedeutet, dass die österreichische Spionageabwehr im gesamten Jahr genau zwei Fälle bearbeitet hat. Ein Fall betraf einen iranischen Staatsbürger, der andere eine bulgarische Verdächtige.
Für ein System, das jährlich Millionen an Steuergeldern verschlingt, ist dies ein Armutszeugnis. Tatsächlich wurde im Zuge der Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) zur DSN im Jahr 2021 beschlossen, jährlich rund 50 Millionen Euro für Personal und moderne IT-Tools zu investieren .
Die Eigenbeschreibung als reaktionsschnelles Frühwarnsystem ist mit diesen Zahlen nicht glaubwürdig. Die Behörde räumt selbst ein, dass das Strafrecht Spionage nur dann erfasst, wenn sie ausdrücklich gegen österreichische Interessen gerichtet ist. Aktivitäten gegen andere europäische Länder oder internationale Organisationen bleiben ohne strafrechtliche Konsequenz.
Wien: Offenes Tor für Nachrichtendienste
Besonders deutlich zeigt sich die Hilflosigkeit im Umgang mit russischen Aktivitäten in Wien. Die russische Botschaft zählt zu den größten in Europa. Wien ist einer der letzten Standorte russischer Signalaufklärung auf europäischem Boden. Parabolantennen ermöglichen dort gezielte Ausspähung militärischer Satelliten anderer Staaten.
Doch selbst bei klarer Bedrohung bleibt das österreichische Strafrecht untätig. Nur wenn eine Handlung unmittelbar gegen österreichische Interessen gerichtet ist, greift das Gesetz. Während andere Länder Personal ausweisen und Botschaften verkleinern, bleibt Österreich untätig. Der Bericht spricht zwar von der Möglichkeit, das technische Personal auszuweisen, zieht aber keine praktischen Konsequenzen. Eine Reduktion der russischen Präsenz in Wien auf das Niveau der österreichischen Vertretung in Moskau wird als sinnvoll beschrieben, doch dieser Gedanke bleibt Theorie.
Desinformation: Die unterschätzte Gefahr
Der Bericht erkennt die wachsende Bedeutung von Desinformation an. Russland nutzt staatliche, finanzielle und technische Ressourcen, um Einfluss auf die europäische Bevölkerung auszuüben. Doch was unternimmt Österreich konkret? Die Ausführungen bleiben vage. Zwar wird erwähnt, dass pro-russische Kampagnen zur Europawahl beobachtet wurden. Doch wie darauf reagiert wurde, bleibt offen. Es gibt keine Informationen über Gegenmaßnahmen, keine Analyse der Folgen, keine messbaren Erfolge.
Cyberangriffe: Unklare Bedrohungslage
Auch im Bereich der Cyberangriffe bleibt das Bild unvollständig. Es gab 2024 insgesamt neunundzwanzig staatsschutzrelevante Vorfälle. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr. Die meisten Angriffe richteten sich gegen Ziele in Wien. In allen Fällen wurde gegen unbekannte Täter ermittelt. Diese Tatsache mag der Natur von Cyberkriminalität geschuldet sein. Dennoch stellt sich die Frage, ob die technischen und forensischen Kapazitäten ausreichen. Von erfolgreich abgewehrten Überlastungsangriffen ist die Rede. Doch der Bericht nennt keine Details zu Auswirkungen auf die kritische Infrastruktur.
Der Fall „Ventil“ zeigt die reale Gefahr. Hacktivisten griffen auf eine österreichische Industriesteueranlage zu und veröffentlichten Screenshots. Noch immer sind zahlreiche dieser Anlagen online zugänglich und unzureichend geschützt. Diese Nachlässigkeit stellt ein unmittelbares Risiko für die Versorgungssicherheit dar. Wer kritische Infrastruktur nicht absichert, handelt fahrlässig.
Weitere Warnsignale, keine Konsequenzen
Mehrere weitere Entwicklungen verdeutlichen das strukturelle Versagen:
- Keine Rückführungen von Terrorverdächtigen: Österreich gehört zu den wenigen westlichen Staaten, die keine aktiven Rückführungen sogenannter Foreign Terrorist Fighters vorgenommen haben. Ein Gerichtsurteil zwang die Behörden zur Handlung. Die vorherige Untätigkeit belegt mangelnde Entschlossenheit bei sicherheitsrelevanten Fragen.
- Symbolpolitik statt Wirkung: Begriffe wie „Truthfluencing“ und „digitale Resilienz“ mögen gut klingen. Doch sie wirken angesichts der realen Gefahren durch digitale Radikalisierung hilflos. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bleibt ungeprüft. Ohne klare Strategien und messbare Resultate handelt es sich um reine Symbolpolitik.
- Wirtschaft ohne Schutz: Nur vierzehn Prozent der betroffenen Unternehmen melden Wirtschaftsspionage an die Behörden. Die Angst vor Reputationsschäden und fehlendes Vertrauen in die Effizienz der DSN sind dafür verantwortlich. Das bedeutet: Die Sicherheitsbehörde hat bei den Unternehmen keine Autorität und kein Vertrauen.
Fazit: Der Bericht ist ein Weckruf
Der Verfassungsschutzbericht 2024 zeigt, dass Österreich auf komplexe und hybride Bedrohungen nicht vorbereitet ist. Die niedrige Zahl an aufgedeckten Spionagefällen ist kein Zeichen von Sicherheit, sondern von Blindheit. Der rechtliche Rahmen ist unzureichend. Die operative Umsetzung ist lückenhaft. Die Bedrohung durch ausländische Nachrichtendienste, Desinformationskampagnen und Cyberangriffe wird nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit bekämpft.
Es ist höchste Zeit, dass die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ihre Aufgaben mit der erforderlichen Konsequenz wahrnimmt. Der Staat darf sich nicht mit einer scheinbaren Erfolgsbilanz zufriedengeben. Die Gesetze müssen verschärft, die Strukturen modernisiert und die Sicherheitsbehörden gestärkt werden. Nur durch klare Verantwortung, entschlossene Umsetzung und ehrliche Analyse kann Österreich seine Sicherheit langfristig gewährleisten.
Die Zeit der Ausflüchte ist vorbei. Jetzt zählen klare Entscheidungen.
Was den Verantwortlichen fehlt, ist Mut zur Verantwortung, der Wille zur Gestaltung und „Chochones“, das auch durchzuziehen.
Quelle
Link wurde vom Netz genommen: Verfassungsschutzbericht 2024